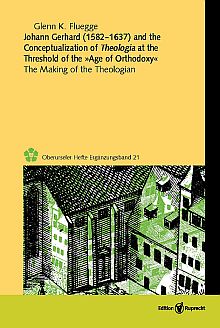Rezension
Lutherische Theologie und Kirche, 45. Jahrgang (2021) Heft 1
Diese profunde Untersuchung über das Theologieverständnis Johann Gerhards, des wohl größten lutherisch-orthodoxen Dogmatikers der frühen Neuzeit, wurde unter der Betreuung von Werner Klän an der Universität Pretoria als Dissertationsarbeit angenommen. Sie verdankt sich dem Interesse sowohl des nordamerikanischen Verfassers als auch des mitteleuropäischen Betreuers an der zeitgenössischen theologischen Ausbildung im globalen Kontext Als Anknüpfungspunkt zwischen den Epochen erweist sich dabei die tatsächlich zeitenübergreifende Thematisierung oder gar Problematisierung des Verhältnisses von theologischer Theorie und kirchlicher bzw. frommer Praxis. Im 17. Jahrhundert wurde dies virulent aufgrund einer gegenüber dem 16. Jahrhundert vorangetriebenen Professionalisierung der Pfarrerschaft und einer damit einhergehenden Intellektualisierung der theologischen Ausbildung. Dagegen wurde immer wieder Protest und Kritik laut Die Beschäftigung mit Gerhard sieht der Verf. dadurch gerechtfertigt, dass dieser sich anders als sein väterlicher Freund und zeitweiliger Seelsorger Johann Arndt nicht zu antiintellektualistischen Ausfällen verleiten ließ, sondern um eine reflektierte Balance von Frömmigkeit und akademischer Theologie bemüht war. Zugleich nimmt Gerhard, so die Ausgangsthese von Fluegge, eine Übergangsstellung ein, indem er den aufkommenden methodischen Aristotelismus in der Theologie rückbindet an die reformatorischen Grundeinsichten des 16. Jahrhunderts. Auf diese Weise gelingt es Gerhard, den Theologiebegriff nicht nur akademisch zu reflektieren, sondern ihn auch geistlich zu gestalten. Als zentral erweist sich dabei die Rezeption und theologische Umformung des ursprünglich aus der aristotelischen Philosophie stammenden »Habitus-Begriffs« durch Gerhard. Im Blickpunkt der gründlichen Textanalysen, die immer wieder kritisch mit dem Vorverständnis des Autors ins Gespräch gebracht werden, stehen jene Quellen, in denen Gerhard den Theologiebegriff grundlegend entfaltet, so die methodische Einleitung ins Theologiestudium (»Methodus«) aus dem Jahr 1620 und vor allem das Prooemium zu den Loci von 1625, aber auch der »Tractatus« über die Schriftauslegung aus dem Jahr 1610 (1). Voraus schickt Fluegge in historischer Perspektive zunächst eine reformationsgeschichtliche, sodann eine zeitgeschichtliche Kontextualisierung von Gerhards theologischer Konzeption.
Zwar reflektierten Luther und Melanchthon den Theologiebegriff noch nicht grundsätzlich. Wohl aber ist bei Melanchthon die Übernahme des Habituskonzepts in seine Logik zu beobachten. In Anknüpfung an Aristoteles verstand er unter dem Habitus eine Kunstfertigkeit, die durch Übung zustande kommt. Luther sah den Begriff skeptisch aufgrund des von ihm in der Scholastik beobachteten Missbrauchs desselben, der zu synergistischen Konsequenzen in der Heilsfrage führen konnte. Gerhards Leistung besteht nun darin, den Begriff so nutzbar zu machen, dass zugleich Luthers Bedenken berücksichtigt werden. Im zeitgeschichtlichen Kontext geht der Jenaer Professor darin den Mittelweg zwischen einer extremen Intellektualisierung der Theologie bis hin zur Behauptung der Möglichkeit einer »theologia non renatorum« an der Universität Helmstedt und einer antiintellektualistischen Reaktion »frommer Kreise« hierauf. Indem er den Habitusbegriff theologisch und praktisch qualifiziert (als »theos-dotos/gottgegeben« und »practica«), wehrt er sowohl dem Synergismus als auch der Loslösung des Akademischen von der Glaubenspraxis.
Plausibilität gewinnt die Rezeption des aristotelischen Habituskonzeptes für Gerhard durch seine im »Tractatus« entfaltete biblische Erkenntnistheorie, in der er in konsequenter Anknüpfung an reformatorische Einsichten die platonische Signifikationshermeneutik als dem Gegenstand der Theologie unangemessen entlarvt. So entspricht die im Habituskonzept angelegte Angleichung des Intellekts an den ihm begegnenden Gegenstand der im Rahtmannschen Streit bekräftigten Einsicht der Reformation, wonach die geistgewirkte illuminatio im Umgang mit der Schrift nicht vom Ausleger, sondern von dieser selbst ausgeht. Hier lässt sich dann auch der Unterschied zum aristotelischen Konzept präzisieren: Während bei Aristoteles der Habitus zu einem dauerhaften Besitz der Person wird, besteht der von Gerhard vertretene theologische Habitus nur im kontinuierlichen Vollzug des Lesens, Meditierens und Erforschens des Wortes Gottes und des damit einhergehenden Betens um die Hilfe des Heiligen Geistes. Es geht nicht um einen statischen Besitz, sondern um einen Zustand des unablässigen Empfangens. Die Bewegungsrichtung ist katabatisch. Die Bindung des Geistes und damit der illuminatio an die Schrift steigert die Notwendigkeit, sich dieser auszusetzen. Glaube und geistgewirkte Schrifterkenntnis lassen sich logisch nicht segmentieren. Ist die Theologie als Aktivität des Intellekts als gottgegeben qualifiziert, so lässt sie sich nicht vom rechtfertigenden Glauben lösen, sondern setzt diesen voraus und wird aufgrund seiner Schriftgebundenheit durch diesen umgriffen. Mit der Qualifikation als »practica« knüpft Gerhard an die reformatorische Kritik an einem spekulativen Theologieverständnis an. Dabei ergänzt er allerdings den Begriff des »Praktischen«, indem er über die reformatorische Betonung der vita passiva in oratio, meditatio und tentatio hinaus (»Autopraxis«) in Anknüpfung an die Medizin auf die »Allopraxis« abhebt, die Bemühung, nicht nur sich selbst im Glauben zu üben, sondern auch andere dazu anzuleiten.
Die im zentralen fünften Kapitel des Buches detailliert erfolgende sprachliche Strukturanalyse der grundlegenden Theologiedefinition im »Prooemium« Gerhards liest sich dann wie eine verifizierende Relektüre der bis hierhin erfolgten Klärungen. Die überragende Gabe Gerhards, komplexe Sachverhalte umfassend und konzise auf den Punkt zu bringen und sie so wiederum einer sachgerechten intellektuellen wie einübenden Aneignung zugänglich zu machen, tritt hier vor Augen. Jenseits aller Vereinseitigung macht Gerhard klar, daß der theologische Habitus im Sinne einer Einübung in die Fähigkeit, andere zu unterweisen (»Allopraxis«), die »Autopraxis« im Sinne einer Angleichung (adaequatio) des Theologen an die Inhalte der Schrift nicht ausschließt, sondern voraussetzt und zugleich zum Ziel führt. Die intellektualistische Verkürzung ist schon darin ausgeschlossen, dass es bei den in der regula fidei zusammengefassten res scripturae ja nicht um abstrakte Wahrheiten, sondern um die Begegnung mit dem dreieinigen Gott geht, von dem selbst durch den Heiligen Geist die erleuchtende Kraft ausgeht Der Transfer der theologischen Erkenntnisse vom Kopf ins Herz bleibt daher nichts Äußerliches oder Zusätzliches, sondern ist Empfang und Vollzug der in der Begegnung mit dem Wort sich ereignenden Gottesbeziehung, die traditionellerweise als »Pietas«, als Frömmigkeit, bezeichnet wird (und die erst Teile des späteren Pietismus isolieren bzw. tendenziell von der Lehre loslösen werden). Theologie und Pietas sind somit zwei Pole des Lebens aus Glauben. So wahr Theologie nicht Selbstzweck ist, sondern als Anleitung zur Glaubenspraxis dient, so wahr ist die persönliche Prägung durch die Glaubensgegenstände gerade auch der Diener im Amt die unabdingbare Voraussetzung für ihre praktisch-professionelle Betätigung. So dient die akademische Theologie kraft ihrer Ausrichtung aufs Predigtamt keinem anderen Zweck als zur Befähigung, andere durch Predigt und Lehre zum Heil zu führen. Und so ist auch in Gerhards Studienordnung die Einübung in die Frömmigkeit unlösbar verbunden mit dem Sprachenstudium und einem umfassenden akademischen Curriculum.
Als vorbildlich erweist sich Gerhard nach Fluegge nicht nur mit seiner gelungenen Synthese alter wie neuer Konzepte im Dienst einer Ausrichtung der theologischen Aufgabe unter sich verändernden Bedingungen, sondern auch dadurch, dass er bei der Mission der Kirche zu jeder Zeit schädliche Engführungen in der Bestimmung der Aufgabe des Predigtamts und der Theologie vermeidet. Dogmatik und Pietas sind in diesem Konzept ebensowenig Gegensätze wie akademische Theorie und kirchliche Praxis. Fluegge verschweigt nicht, dass auch Gerhards Konzeption nicht verhindert hat, dass die notwendige Zusammengehörigkeit beider Aspekte in der nachfolgenden Epoche zusehends im Konflikt mit und zwischen Aufklärung und Pietismus aus dem Blick geriet. Inwieweit man hier dann – an beiden Enden des Spektrums – noch in der Lage war und ist, dem reformatorischen Fundamentalkriterium der Rechtfertigung und damit der Vermeidung eines intrinsischen Synergismus gerecht zu werden, ist eine Frage, die sich auf der Basis von Gerhards Theologieverständnis stellen lässt.
So weist Fluegges wichtige Arbeit auch heute allen, denen Theologie und Kirche am Herzen liegen, den goldenen Mittelweg jenseits eines frömmelnd-schwärmerischen Anti-Intellektualismus einerseits und einer geistlosen Akademisierung andererseits. Schon aus diesem Grund, aber auch aufgrund der pädagogisch geschickten und mit mehreren Graphiken veranschaulichten Aufbereitung der untersuchten Sachverhalte sind dem Buch von Fluegge viele Leser und womöglich eines Tages auch eine deutsche Übersetzung zu wünschen. Eine lesenswerte deutschsprachige Hinführung bietet einstweilen die von Werner Klän beigegebene Zusammenfassung am Ende des Bandes.
Armin Wenz
(1) Vgl. zu Letzterem meine Besprechung zur historisch-kritisch edierten Ausgabe: Tractatus de legitima scripturae sacrae interpretatione (1610). Lateinisch-deutsch. Kritisch herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Johann Anselm Steiger unter Mitwirkung von Vanessa von der Lieth. Mit einem Geleitwort von Hans Christian Knuth (Doctrina et Pietas Abtl. I; Johann-Gerhard-Archiv, Band 13), Stuttgart/Bad Cannstatt 2007, in: Logia. A Journal of Lutheran Theology XVIII. Number 1, Epiphany 2009, 52−54.